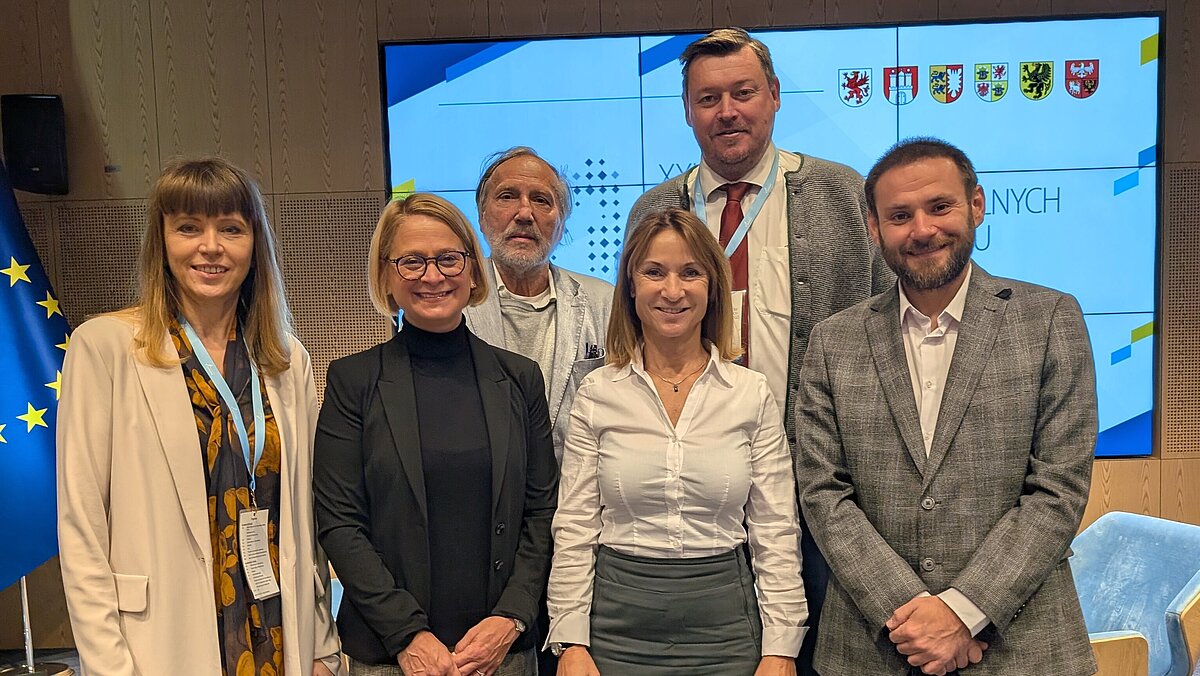Das 21. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Stettin: Saubere Luft als Chance für nachhaltige Entwicklung – Marschall Geblewicz spricht zu den Beteiligten
Vom 28. bis 30. September 2025 fand auf Einladung des Sejmik der Woiwodschaft Westpommern das 21. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Stettin statt. Rund 60 Abgeordnete, Experten und Gäste aus den polnischen Woiwodschaften Ermland-Masuren, Pommern, Westpommern und aus den deutschen Partnerregionen Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern trafen sich in der westpommerschen Hauptstadt, um konkrete Handlungsempfehlungen für die nationalen und regionalen Regierungen in der südlichen Ostseeregion zum Thema „Luftreinhaltung“ zu verabschieden. Unter der Leitung von Frau Präsidentin Birgit Hesse nahmen seitens des Landtages Mecklenburg-Vorpommern Frau Vizepräsidentin Beate Schlupp sowie die Abgeordneten Marcel Falk, Prof. Dr. Robert Northoff, Dr. Sylva Rahm-Präger und Christian Albrecht an der Jahreskonferenz des Parlamentsforums teil. Als Expertin aus Mecklenburg-Vorpommern berichtete Frau Ute Hennings, Direktorin des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie, über die Ergebnisse der Luftgüteanalyse 2025 und die langjährigen Trends in Mecklenburg-Vorpommern.
Die gemeinsame Resolution wurde inhaltlich durch die internationale Expertenanhörung und die Redaktionskonferenz vorbereitet, die der Landtag in der Landesvertretung in Berlin vom 12. bis zum 13. Mai 2025 durchgeführt hat. Im kommenden Jahr wird der Landtag das 22. Parlamentsforum in Schwerin organisieren, während die internationale Anhörung in Westpommern ausgerichtet wird.
Saubere Luft im Fokus der Regionen der südlichen Ostsee
Zu Beginn der Konferenz betonte die Gastgeberin Teresa Kalina, Vorsitzende des Sejmik der Woiwodschaft Westpommern, dass die Luftreinhaltung unmittelbar zur Lebensqualität der Bevölkerung beitrage. Westpommern habe in den vergangenen Jahren über 1.500 Projekte in Bereichen wie Verkehr, Bauwesen und Energie umgesetzt, die alle dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung dienten. Auch Frau Präsidentin Birgit Hesse unterstrich, dass Luftverschmutzung kein lokales Problem sei: Feinstaub, Emissionen aus Verkehr, Schifffahrt, Landwirtschaft und Industrie machten an der Grenze nicht halt. Um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, müsse entschlossen gehandelt werden – gemeinsam, koordiniert und ergebnisorientiert. Mecklenburg-Vorpommern investiere seit Jahren in die Verbesserung der Luftqualität, vor allem in drei Bereichen: Einsatz von Landstromanlagen in Häfen, Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft und Verringerung der Luftverunreinigungen durch die Landwirtschaft.
In seiner Rede bekräftigte der Marschall der Woiwodschaft Westpommern Olgierd Geblewicz, dass Westpommern mit zahlreichen Projekten in den Bereichen erneuerbare Energien, Gebäudemodernisierung und Infrastruktur beispielgebend vorangehe. Saubere Luft sei dabei nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern zugleich ein Motor für wirtschaftliche Entwicklung, neue Technologien und Tourismus. Auch Jakob Kowalik, Vize-Marschall von Westpommern, unterstrich, dass die Woiwodschaft Westpommern hohe Investitionen in die Nachhaltigkeit betätige und bereits heute mehr erneuerbare Energie produziere, als sie verbrauche. Damit sei Westpommern ein Beispiel für die grüne Transformation. Anschließend verwies Piotr Lyczko, stellvertretender Direktor im Umweltministerium, auf die Fortschritte Polens durch Anti-Smog-Beschlüsse und Reformen der letzten Jahre. Angesichts neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und verschärfter EU-Grenzwerte sei das Problem der Luftreinhaltung jedoch keineswegs gelöst. Entscheidend seien systematisches Vorgehen, entschlossenes Handeln und umfassende Aufklärungskampagnen, um gesellschaftliche Akzeptanz zu sichern.
Die Delegationsleitungen aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Pommern und Ermland-Masuren hoben in ihren Ansprachen hervor, dass Luftreinhaltung nicht allein eine Umweltfrage sei, sondern auch eng mit Fragen von Sicherheit, Demokratie und wirtschaftlicher Innovation verknüpft sei. Carola Veit, Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, sprach insbesondere die Schifffahrt als bedeutende Emissionsquelle an und forderte, vorhandene Technologien konsequenter einzusetzen. Kristina Herbst, Präsidentin des Landtages Schleswig-Holstein betonte, dass Sicherheit mehr umfasse als nur militärische Aspekte, und verwies auf die Bedeutung gemeinsamer Nachhaltigkeitsinitiativen im Ostseeraum. Szymon Redlin aus der Woiwodschaft Pommern unterstrich, dass Investitionen in saubere Luft zugleich Impulse für innovative Wirtschaft und Beschäftigung setzten. Förderprogramme, Modernisierung der Wärmequellen und Informationskampagnen seien dabei zentrale Bausteine.
Strategien und Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität: Beispiele aus den Regionen
Fachvorträge von Expertinnen und Experten aus Deutschland und Polen beleuchteten verschiedene Aspekte: die Entwicklung emissionsarmer Schifffahrtstechnologien, den Ausbau von Messnetzen, die gesundheitlichen Folgen von Luftverschmutzung sowie regionale Programme zur Energiesanierung. Diskutiert wurden zudem Fragen zu alternativen Treibstoffen, Messverfahren, rechtlichen Instrumenten und Bürgerbeteiligung.
Für die Entwicklung konkreter Maßnahmen seien verlässliche wissenschaftliche Daten und Informationen notwendig. So berichtete der Leiter der Regionalabteilung für Umweltüberwachung beim Hauptinspektorat für Umweltschutz in Olsztyn Tomasz Zalewski über den Ausbau des Messnetzes in Ermland-Masuren, insbesondere der Verkehrsmessstationen. Angesichts steigender Fahrzeugzahlen sei dies entscheidend, um Emissionen transparent zu erfassen. Die Direktorin des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern Ute Hennings präsentierte die aktuellen Luftgüte-Trends in Mecklenburg-Vorpommern und wies darauf hin, dass insbesondere beim Feinstaub nach Inkrafttreten neuer EU-Grenzwerte Probleme zu erwarten seien. Doch 2024 erfüllte das Land verlässlich die Anforderungen der Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa, was auch für 2025 auf Basis der bisher beobachteten Werte der Fall sein solle.
Mit Blick auf generelle Trends und Entwicklungen legte Dr. Martin Ramacher, Experte für Luftqualität am Helmholtz-Zentrum Hereon, die gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung im Ostseeraum dar. Studien belegten, dass die Belastung für die Bevölkerung oft höher sei als angenommen, sowohl im Außen- als auch im Innenraum.
Hinsichtlich der regionalen Maßnahmen und technologischen Innovationen stellte Dr. Gesa Ziemer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) das Konzept eines modularen Forschungsschiffes vor, das als Labor zur Erprobung neuer Antriebe und Treibstoffe dienen und so die maritime Energiewende beschleunigen solle.
Vertreterinnen und Vertreter der Woiwodschaften Pommern und Westpommern präsentierte konkrete Programme für die energetische Heizungssanierung. Paulina Górska, stellv. Direktorin der Abteilung für Umwelt und Landwirtschaft, Marschallamt der Woiwodschaft Pommern, stellte die Anti-Smog-Beschlüsse vor, die den Austausch von alten Wärmequellen und Heizungsanlagen vorsahen und erwähnte eine Reihe von begleitenden Maßnahmen, darunter Informationskampagnen und ein zinsloses Darlehensinstrument für energetische Sanierungen für Bürgerinnen und Bürger. Waldemar Miśko, Vorstandsvorsitzender des Woiwodschaftsfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft in Stettin, widmete seine Präsentation einem Pilotprojekt zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden in ehemaligen Siedlungen von staatlichen landwirtschaftlichen Einrichtungen („PGR-Siedlungen“), das durch EU-Mittel und nationale Fonds unterstützt werde. Im Rahmen des Projekts sollten tausend Gebäude bis spätestens 2029 energetisch modernisiert werden.
In den Podiumsdiskussionen wurde deutlich, dass die Verbesserung der Luftqualität eine enge Verzahnung von Technologie, Regulierung und gesellschaftlicher Akzeptanz erfordere. Ein wiederkehrendes Thema war die Notwendigkeit, die Bevölkerung stärker einzubeziehen und verständlich über wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren. Nur so könne Desinformation entgegengewirkt und Vertrauen in Maßnahmen zur Luftreinhaltung geschaffen werden.
Jugendforum des Parlamentsforums Südliche Ostsee
Das parallel zur Jahreskonferenz durchgeführte Jugendforum stellte drei Forderungen: die vollständige und überprüfbare Umsetzung der EU-Luftqualitätsrichtlinie in nationales Recht bis zum vorgesehenen Stichtag; darüber hinaus sprachen sich die jungen Erwachsenen für die bestmögliche Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten und verwiesen auf die Empfehlungen der WHO als zusätzliche Orientierung.
Ausblick auf das 22. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Schwerin
Das 21. Parlamentsforum machte deutlich: Saubere Luft sei eine gemeinsame Aufgabe, deren Umsetzung enge grenzüberschreitende Kooperation, mutige politische Entscheidungen, wissenschaftliche Innovationen und breite gesellschaftliche Akzeptanz erfordere. Zum Schluss bedankte sich Frau Präsidentin Birgit Hesse bei den Gastgeberinnen und Gastgebern, den Teilnehmenden der Jahreskonferenz und des Jugendforums für die konstruktive und konsensorientierte Zusammenarbeit in Stettin und sprach eine Einladung zum kommenden Parlamentsforum nach Schwerin aus.
Das 22. Parlamentsforum Südliche Ostsee wird vom 31. Mai bis 2. Juni 2026 durch den Landtag Mecklenburg-Vorpommern im Schweriner Schloss zum Thema „Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken“ ausgerichtet.