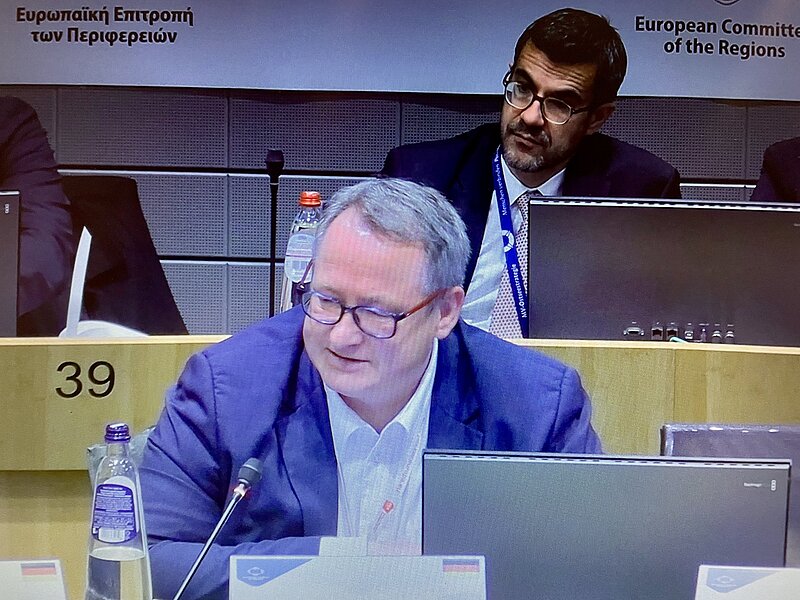Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses der Ostseeparlamentarierkonferenz (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC), in dem der Landtag Mecklenburg-Vorpommern durch seine Erste Vizepräsidentin Beate Schlupp vertreten ist, hielten am 15. November zum ersten Mal seit zwanzig Monaten eine Präsenzsitzung in der Handelskammer Hamburg ab. Diskutiert wurden dabei die Vorschläge des Baltic Sea NGO Network (BSNGON) zur Erweiterung und Vertiefung der Kooperation zwischen der Ostseeparlamentarierkonferenz und den zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Ostseeregion sowie mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels angesichts der Erkenntnisse des Sechsten Sachstandberichts des Weltklimarates (International Panel on Climate Change, IPCC) und der Ergebnisse der 26. Weltklimakonferenz. Darüber hinaus stellte die Staatsrätin und Bevollmächtigte der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten Almut Möller die Aktivitäten der Stadt Hamburg zur Förderung der Ostseekooperation vor. Der aktuelle Präsident der Ostseeparlamentarierkonferenz und Abgeordnete des schwedischen Parlaments Pyry Niemi erhielt zudem in einer feierlichen Zeremonie eine Medaille der Baltischen Versammlung (Baltic Assembly, BA) für seinen Beitrag zur Einheit und Zusammenarbeit zwischen den baltischen Staaten.
Stärkung der Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft und Jugend
Am Anfang der Sitzung präsentierte der Vertreter des BSNGON Anders Bergström drei Vorschläge für die Weiterentwicklung der Kooperation zwischen der BSPC und dem NGO-Netzwerk. So wurden Parlamentarierinnen und Parlamentarier zum so genannten Participation Day eingeladen, um sich mit Teilnehmenden über potentielle Ideen und Vorhaben für Flaggschiffprojekte im Rahmen der EU-Ostseestrategie (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) auszutauschen. Zudem bestehe die Möglichkeit, gemeinsam mit dem BSNGON und den Koordinatoren der EUSBSR-Politikbereiche (Policy Areas) nationale Workshops zu den sich überschneidenden Schwerpunkten der EU-Ostseestrategie, des Ostseerat-Vorsitzes (Council of the Baltic Sea States, CBSS) und der BSPC zu organisieren. Der Vorschlag, der auf großes Interesse gestoßen ist, sieht eine Institutionalisierung der bestehenden regionalen Expertenkooperation in Form einer Denkfabrik für den Ostseeraum vor. In der anschließenden Diskussion wurde wiederholt auf die Potentiale eines verbesserten interregionalen Austausches zwischen politischen, zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren hingewiesen. In unterschiedlichen Ländern würden Fachleute an ähnlichen Problemstellungen arbeiten; die Förderung einer verbesserten Kommunikation und Konsolidierung nationaler Erkenntnisse und Erfahrungen würde deshalb helfen, Arbeitsdoppelungen zu vermeiden.
Die Zusammenarbeit mit der jungen Generation stellt neben der Verbesserung der Kooperation mit der Zivilgesellschaft einen weiteren Schwerpunkt des aktuellen schwedischen BSPC-Vorsitzes dar. In diesem Zusammenhang reflektierte der Ständige Ausschuss über das im Vorfeld der 30. Ostseeparlamentarierkonferenz am 28. August 2021 abgehaltene Ostseejugendforum (Baltic Sea Parliamentary Youth Forum) und bezeichnete es als großen Erfolg. Die Teilnehmenden des Forums äußerten den Wunsch nach echter Einbeziehung der Jugendlichen in Entscheidungsprozesse und bedankten sich für die Möglichkeit, ihre Ideen, Anliegen und Kritik an die Politik heranzutragen. Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses unterstrichen die Bedeutung solcher Kooperations- und Kommunikationsformate und hoben den Mehrwert einer Zusammenarbeit mit anderen regionalen Institutionen, z. B. dem Ostseerat, sowie nachhaltiger Finanzierung hervor.
Innovative Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels
Im Rahmen des traditionellen Austausches mit Fachleuten zu den BSPC-Schwerpunktthemen berichtete die Direktorin des Climate Service Center Germany (GERICS) und Gastprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg Prof. Dr. Daniela Jacob über die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie politischen Entscheidungen im Bereich des Klimawandels. Im März 2021 sei die höchste CO2-Konzentration in der Atmosphäre erreicht worden. Es sei bewiesen worden, dass die globale Klimaerwärmung auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen sei. Der jüngste Sachstandbericht des Weltklimarates habe gezeigt, dass der Anstieg der CO2-Emissionen einen weiteren Temperatur- und Niederschlaganstieg verursache. Zudem würde jeder 0,5-Grad-Anstieg eine Zunahme von Wetterextremen bedeuten. Ein globaler Temperaturanstieg von 2 Grad im Vergleich zur präindustriellen Zeit würde zu irreversiblen Veränderungen führen und ganze Regionen unbewohnbar machen. Das 1,5-Grad-Ziel könnte bereits in den nächsten 20 Jahren überschritten werden, daher seien Klimaschutzmaßnahmen dringend notwendig. Dazu gehöre eine Umverteilung der Investitionen aus dem fossilen Energiesektor zur klimaneutralen Energie, eine Entkarbonisierung des Energiesektors, eine Entwicklung in Richtung klimaneutraler Gesellschaften sowie eine Kompensation von Rest-Emissionen. Man brauche nicht nur Kohlenstoffspeicherung, sondern auch -verarbeitung.
Die 26. Weltklimakonferenz habe erste Schritte im Bereich der Reduktion von Methanemissionen unternommen, was laut Prof. Dr. Jacob eine wichtige Entwicklung darstelle. Auch wenn die am Ende vereinbarten Maßnahmen nicht ausreichen würden, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, seien die Bemühungen lobenswert gewesen. Es sei positiv zu bewerten, dass Staaten angefangen hätten, miteinander zu reden, was die Verhandlungen zwischen den USA und China gezeigt hätten. Die durch einige europäische Länder unternommenen Schritte hätten auch ein gutes Signal gesendet. Es sei jedoch bedauernswert, dass die Frage der Klimagerechtigkeit nicht ausreichend adressiert worden sei. Gleichzeitig seien Staaten, nicht die Klimakonferenz, für die Formulierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen sowie für die Kommunikation und die Stärkung des öffentlichen Problembewusstseins verantwortlich. Die effektive Bekämpfung der Klimakrise werde eine Entwicklung neuer Technologien benötigen, wie der Direct Air Capture (DAC) sowie der Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS). Zugleich sollten sowohl große CO2-Filteranlagen für die Industrie, als auch CO2-Filter für individuelle Häuser zum Einsatz gebracht werden.
Prof. Dr. Jacob betonte abschließend, dass die Bekämpfung der Klimakrise keine Rückkehr in die sechziger Jahre bedeuten würde. Das gesammelte Wissen und das bessere Verständnis des Klimasystems sollten zu einem Übergang in eine ganz andere – nachhaltigere und innovativere – Ära führen.
Die Situation an der Grenze zu Belarus
Angesichts der Zuspitzung der Lage an den polnisch-belarussischen und litauisch-polnischen Grenzen besprach der Ständige Ausschuss die drohende humanitäre Krise und unterstrich die Notwendigkeit, Solidarität mit den betroffenen Ländern zu zeigen und als Region geschlossen und entschlossen zu agieren, um menschliches Leid zu mindern. Im Konsens beschlossen die Mitglieder des Ständigen Ausschusses eine Stellungnahme, in der die belarussischen Behörden aufgefordert werden, humanitären Organisation uneingeschränkten Zugang zum Grenzgebiet zu gewähren. Zudem werden die Staaten der Region aufgerufen, zusammenzuarbeiten, um den organisierten Menschenschmuggel in die BSPC-Mitgliedsländer ein Ende zu setzten.
Das englischsprachige Original der Stellungnahme wurde auf der BSPC-Website veröffentlicht. Hier findet sich die inoffizielle deutsche Übersetzung:
Stellungnahme des Ständigen Ausschusses der Ostseeparlamentarierkonferenz
Die Teilnehmenden, die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Staaten der Ostseeregion, versammelt am 15. November 2021 in Hamburg, verabschiedeten die folgende Stellungnahme:
Der Ständige Ausschuss der BSPC,
bezugnehmend auf die sich rapide verschlechternde humanitären Lage an den Grenzen Polens und Litauens zu Belarus,
bezugnehmend auf die zahlreichen Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die jegliche Formen des Menschenhandels auf Schärfste verurteilen,
äußert seine tiefe Besorgnis über den unzureichenden Zugang humanitärer Organisationen zum Grenzgebiet zur Gewährung humanitärer Grundversorgungsleistungen für Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten,
fordert die belarussischen Behörden nachdrücklich auf, humanitären Organisationen uneingeschränkten Zugang zur Versorgung an der Grenze leidender Migrantinnen und Migranten mit Nahrung, Unterkunft und medizinischer Betreuung zu gewähren,
ruft die Länder der Region auf, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, dem organisierten Menschenschmuggel in die BSPC-Mitgliedsländer ein Ende zu setzten, und
fordert weiterhin alle Staaten und internationalen Institutionen auf, verantwortungsvoll zu handeln um menschliches Leid zu mindern.