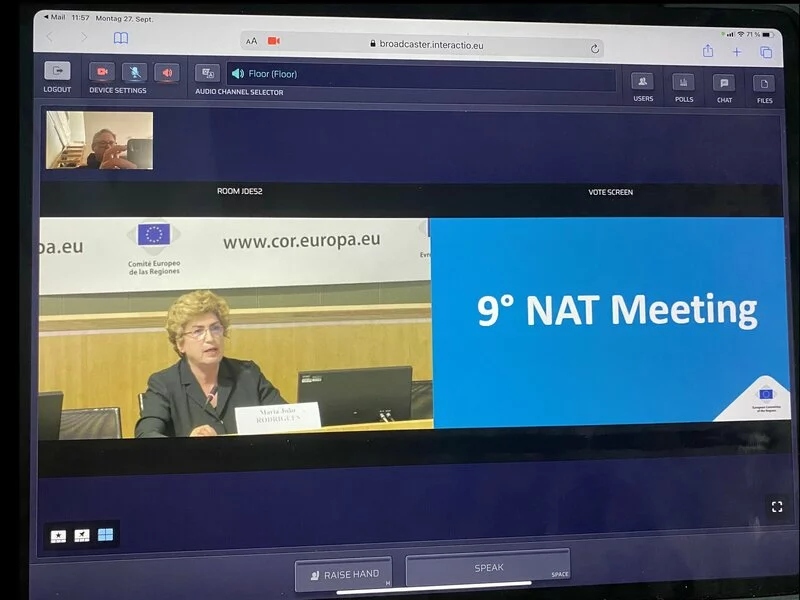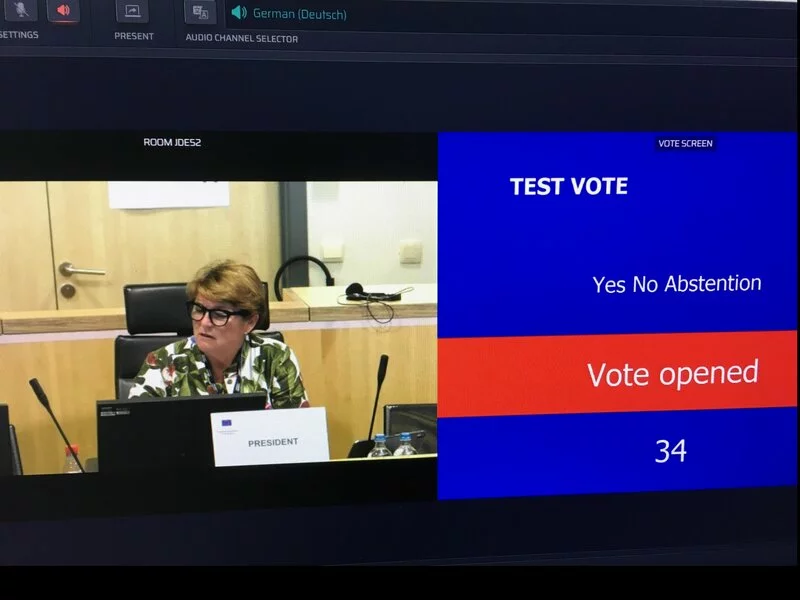Tilo Gundlack, MdL bei der 9. Sitzung der Fachkommission für natürliche Ressourcen des Europäischen Ausschusses der Regionen: Für nachhaltige Produktions- und Verbrauchsmuster in der EU
Am 27. September 2021 nahm Tilo Gundlack, MdL online an der 9. Sitzung der Fachkommission für natürliche Ressourcen (NAT) des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR) teil.
Dabei standen die Themen ökologische Landwirtschaft, ländlicher Raum – unter anderem die dortige Gesundheitsversorgung – neben der Krebsbekämpfung und nachhaltigen Meereswirtschaft im Vordergrund. Die Fachkommission NAT hat in ihrer Sitzung drei Stellungnahmen verabschiedet.
EU-Aktionsplan für ökologische Landwirtschaft
Laut der EU-Mitteilung über einen Aktionsplan zur Förderung der ökologischen/biologischen Produktion sind nicht nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren nach wie vor eine entscheidende Ursache für den Verlust an biologischer Vielfalt. Derzeit entfallen 8,5 % der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche der EU auf die ökologische/biologische Bewirtschaftungsform.
Eine von der Fachkommission NAT angenommene Stellungnahme zum EU-Aktionsplan für ökologische Landwirtschaft fordert die EU-Mitgliedstaaten unter anderem auf, zu untersuchen, wie das Verursacherprinzip hinsichtlich Pestizidrückständen in der Umwelt, die unter anderem auch Bio-Landwirte beeinträchtigen, umgesetzt werden kann. Sie weist darauf hin, dass es sehr wichtig ist, die gemeinsame Haftung von landwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen der konventionellen Landwirtschaft zu berücksichtigen, die das Pestizid in die Umwelt freigesetzt haben. Die Stellungnahme geht außerdem auf Möglichkeiten für ein Tierschutzlabel, die Einrichtung von Bio-Regionen, die Erhaltung von Wasserressourcen und das Angebot von Bio-Erzeugnissen in Kantinen ein. Sie schlägt vor, das Bio-Logo der EU durch den Zusatz „Bio aus der EU“ unter dem grünen Blatt zu ergänzen, um für einen besseren Erkennungseffekt bei den Verbrauchern zu sorgen, mit der Möglichkeit, die Region anzugeben, aus der das Produkt kommt.
Die AdR-Stellungnahme bedauert, dass die Gemeinsame EU-Agrarpolitik nicht im Einklang mit den Zielen des EU-Aktionsplans für ökologische/biologische Landwirtschaft, des Grünen Deals, der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie der EU steht und dass Landwirte, die Anstrengungen unternehmen, um den ökologischen Wandel in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb zu vollziehen, beispielsweise indem sie ihre Flächen für den ökologischen Landbau nutzen, nicht belohnt werden können.
Sie begrüßt ferner das ehrgeizige Ziel der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, bis zum Jahr 2030 mindestens 25 % der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch/biologisch zu bewirtschaften, betont, dass Nachfrage und Produktion in diesem Bereich gefördert werden müssen und schlägt vor, verbindliche nationale Ziele festzulegen, um der Vielfalt der Landwirtschaft in den verschiedenen europäischen Ländern Rechnung zu tragen. Der EU-Kommission empfiehlt sie, nationale Strategiepläne gründlich darauf zu überprüfen, ob sie mit den Zielen des Grünen Deals in Einklang stehen, und außerdem zu bewerten, wie sie dazu beitragen, das 25 %-Ziel ökologisch/biologisch bewirtschafteter landwirtschaftlicher Flächen zu erreichen. Auch legt sie der der EU-Kommission nahe, für eine angemessene Unterstützung zu sorgen und die Mittel für Forschung und Entwicklung für die Bio-Landwirtschaft, die ökologische Aquakultur und die Bio-Tierhaltung in der EU aufzustocken, um dem Mangel an eigenen Ressourcen, namentlich an Saatgut mit Bio-Siegel und ökologisch/biologisch produzierten Eiweiß- und Vitamin-B-Futtermitteln, zu begegnen und die Abhängigkeit von Importen zu verringern.
Eine neue EU-Bio-Verordnung wird ab dem 1. Januar 2022 gelten.
Maritime Berufe im Mittelpunkt - nachhaltige blaue Wirtschaft und Aquakultur: Für eine stärkere Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
In einer weiteren von der Fachkommission NAT verabschiedeten Stellungnahme begrüßen die Mitglieder die Mitteilung der EU-Kommission „Über einen neuen Ansatz für eine nachhaltige blaue Wirtschaft in der EU – Umgestaltung der blauen Wirtschaft der EU für eine nachhaltige Zukunft“, in der eine Strategie für nachhaltige maritime Branchen und Industrien festgelegt wird. Die Stellungnahme kritisiert, dass in den nationalen Plänen und Strategien für intelligente Spezialisierung die maritime Wirtschaft nicht ausreichend berücksichtigt und finanziell unterstützt werde. Ferner fordert sie eine klare Begriffsdefinition „nachhaltiger“ Aquakultur und fordert die EU-Kommission und die nationalen Regierungen auf, die Regionen bei der Entwicklung der maritimen Wirtschaft zu konsultieren.
Laut der Universität Rostock und dem in Braunschweig ansässigen Johann Heinrich von Thünen-Institut hat die Aquakulturproduktion eine Reihe von Auswirkungen auf die sie umgebende Umwelt: So wird bei einer offenen Produktion der unkontrollierte Eintrag von Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor festgestellt. Zudem kann es auch zur Übertragung von Krankheiten von Aquakulturtieren auf wildlebende Tiere kommen, oder Zuchttiere können entkommen und sich mit wildlebenden Artgenossen verpaaren und somit zu einer Veränderung der natürlichen genetischen Vielfalt beitragen. Die Verfütterung von wildgefangenem Fisch sei aber einer der wichtigsten Kritikpunkte der Aquakultur, während Umweltsiegel den Verbraucherinnen und Verbrauchern Orientierung hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Aquakultur bieten können. In der Stellungnahme der Fachkommission NAT wird unter Bekräftigung des Vorschlags eines EU-Umweltsiegels und im Sinne der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit auf die Notwendigkeit hingewiesen, Tierschutz-, Klima- und Gesundheitsstandards einzuhalten und die Verbraucher auf den Etiketten ausreichend und korrekt zu informieren. Die Stellungnahme spricht sich für die lokale Erzeugung sowie kurze Versorgungsketten aus und verweist darauf, dass zahlreiche Studien die entscheidende Bedeutung der biologischen Vielfalt der Meere für die Gesundheit des Planeten und das soziale Wohlergehen belegen.
Die Stellungnahme der Fachkommission NAT weist in diesem Zusammenhang auf die Ziele der EU-Strategie vom „Hof auf den Tisch“ hin: Diese strebt eine Verringerung des Antibiotika-Einsatzes und die Ausweitung der ökologischen Aquakultur an.
Des Weiteren begrüßt die Stellungnahme die Absicht der EU-Kommission, die Städte und Regionen im Küstenbereich bei der Bewältigung des ökologischen und digitalen Wandels auf lokaler Ebene und bei der vollen Inanspruchnahme von Mitteln und Anreizen, die die EU bereitstellt, zu unterstützen, indem sie ein Unterstützungspaket zur Erholung (eine „Blaupause für lokale Grüne Deals“) sowie strategische Leitlinien (z. B. die Initiative „Intelligent Cities Challenge“) ausarbeiten wird. Die Aquakultur sollte als eigener Politikbereich anerkannt werden, sie soll die traditionelle Fischerei ergänzen
In der Stellungnahme wird außerdem darauf hingewiesen, dass eine Stärkung der Attraktivität maritimer Berufe und nachhaltige Investitionen für eine erfolgreiche blaue Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Sie bedauert die Mittelkürzung bei Interreg, und hebt die Wichtigkeit hervor, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, die öffentliche und private Investitionen in die Entwicklung der blauen Wirtschaft erleichtern und stimulieren. Des Weiteren sei es notwendig, Innovationen und die Entwicklung neuer Produkte zu finanzieren, in innovative Technologien und intelligente Lösungen zu investieren und neue Technologien wie Meeresenergie aus erneuerbaren Quellen, die maritime Industrie oder Biounternehmen der blauen Wirtschaft zu unterstützen. Häfen sollten zu Energiezentren werden, und von der EU-Kommission fordert die Stellungnahme, dass sie sich bei nachhaltigen Investitionen in den maritimen Sektor stärker auf die regionalen Strategien für intelligente Spezialisierung (RIS3) stützt zur Schaffung von Netzen der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene unter dem Titel „European Sea tech“. Die Forderung nach einer Ausarbeitung von Vorschlägen zur maritimen Raumplanung und zur Festlegung von ökologischen Korridoren bekräftigt sie, in denen es gelingt, den Rückgang der biologischen Vielfalt umzukehren, zur Eindämmung des Klimawandels und zur Stärkung der Resilienz gegenüber dem Klimawandel beizutragen und zugleich finanziellen und gesellschaftlichen Nutzen daraus zu ziehen, um das Ziel eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Entnahme von Fischbeständen und ihrer Reproduktionsfähigkeit zu erreichen. Die Stellungnahme fordert außerdem, den künftigen CO2-Grenzausgleichsmechanismus auf die Fischerei- und Aquakulturprodukte anzuwenden und die Einfuhr von Produkten zu unterbinden, die mit Menschenrechtsverletzungen und niedrigen Sozial- und Ökostandards in Verbindung stehen.
Für eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der EU und mehr europäische Wertschöpfungsketten im Agrar- und Lebensmittelsektor
Ende Juni 2021 legte die EU-Kommission ihre Mitteilung „Eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der EU – Für stärkere, vernetzte, resiliente und florierende ländliche Gebiete bis 2040“ vor, die Maßnahmen vorsieht, um gemäß Artikel 174 AEUV regionale Unterschiede zu verringern. Sie enthält einen Pakt sowie einen Aktionsplan für den ländlichen Raum bezogen auf die Bereiche Dienstleistungen, Infrastruktur, Ökologie, Fortbildung und Beschäftigung und wirtschaftliche Diversität.
Das Arbeitsdokument der Fachkommission NAT führt dazu aus, dass der Programmplanungszeitraum des Aktionsplans ausgeweitet und auch die Aspekte externer Wettbewerb, instabile Preise und Verteilung der Bruttowertschöpfung Berücksichtigung finden sollten. Es unterstreicht zudem, dass der nachhaltige ländliche Tourismus sowie freizeit- und kulturbezogene Aktivitäten, u.a. solche typischen wie das Wandern und die Jagd, stärker gewürdigt werden sollten. Außerdem fordert das Arbeitsdokument des AdR jene lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die noch keinen Aktionsplan/keine Strategie für den ländlichen Raum ausgearbeitet haben, auf, dies zu tun und die Initiativen LEADER/CLLD (Vernetzung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft/Von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung) und Intelligente Dörfer (strategische Innovationskonzepte im ländlichen Raum: Initiativen ländlicher Gemeinden, um spezifischen Herausforderungen zu begegnen) zu stärken. Das Arbeitsdokument enthält zudem die Forderung an die EU-Kommission, hinsichtlich der Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft in der Klimakrise und einer gerechten und inklusiven Gestaltung des ökologischen und digitalen Wandels Überwachungs-, Analyse- und Unterstützungsinstrumente bereitzustellen.
Europas Plan gegen den Krebs
Die von der Fachkommission NAT angenommene Stellungnahme bezüglich Europas Plan gegen Krebs hebt hervor, dass die Gesundheitspolitik nach wie vor eine vorrangig mitgliedstaatliche Aufgabe ist, jedoch in den Debatten im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas, die am 9. Mai 2021 lanciert wurde, auf EU‑Ebene Überlegungen über Zuständigkeiten im Gesundheitsbereich angestellt werden sollten.
Die Stellungnahme fordert die EU-Organe auf, dafür zu sorgen, dass im Rechtsrahmen für die künftige EU-Gesundheitsunion die Verantwortung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften für die öffentliche Gesundheit berücksichtigt wird, da sich 19 der 27 Mitgliedstaaten dafür entschieden haben, den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Hauptverantwortung für die Gesundheitsversorgung zu übertragen. Außerdem weist die Stellungnahme auf einen Vorsorge- und Behandlungsstau durch die COVID-19-Pandemie, auf die gestiegene Zahl der Krebserkrankungen sowie auf die nötige Erweiterung des Gesundheitswissens der EU-Bürger hin. Dies zum Beispiel bzgl. der Risiken krebserregender Stoffe und Strahlung, Umweltverschmutzung, des Rauchens, Alkoholkonsums und Fettleibigkeit, bestimmter Infektionskrankheiten sowie des Bewegungsmangels. In der Stellungnahme weist der AdR auch darauf hin, dass der Wirtschaft bei der Förderung einer gesunden Lebensweise eine wichtige Rolle zukommt.
Sie regt ferner eine HPV-Impflicht für Jugendliche, eine Ausweitung der Krebsfrüherkennung und einen gleichen Zugang zu Versorgungsleistungen aller Bürger in der EU an. Zusätzlich fordert sie die EU-Mitgliedstaaten auf, die Akkreditierung von mindestens einem Krebszentrum pro Mitgliedstaat nach dem Standard der Organisation Europäischer Krebsinstitute zu fördern.
Der Plan der EU-Kommission, der mit dem Forschungsauftrag zum Thema Krebs im Rahmen des Programms Horizont Europa verknüpft ist, sieht unter anderem vor, die Möglichkeiten des Datenaustauschs und der Digitalisierung sowie der EU-Initiative über bildgebende Verfahren besser zu nutzen. Außerdem soll ein Wissenszentrum zur Krebsbekämpfung geschaffen werden, wobei sich die Stellungnahme des AdR dafür einsetzt, dessen Kompetenzen auf die Behandlung seltener Krebsarten auszuweiten.
In der Sitzung der Fachkommission NAT wurde zudem ein gemeinsamer Aktionsplan zwischen dem UN-Regionalbüro in Europa für die Verringerung des Katastrophenrisikos und dem AdR unterzeichnet.